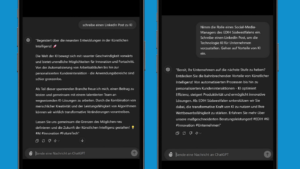Sozio-robotische Innovation in der Rehabilitation
Zusammenarbeit zwischen MarienAktiv und der Universität Siegen
In einer spannenden Kooperation mit dem MarienAktiv Therapiezentrum und der Universität Siegen wurde der Telepräsenzroboter Temi für drei Wochen erfolgreich in der orthopädischen Reha eingesetzt. Dieses Projekt zielte darauf ab, die Rehabilitationsprozesse durch innovative Technologie zu unterstützen und den Patienten eine abwechslungsreiche und motivierende Trainingsumgebung zu bieten.
Funktionen und Möglichkeiten von Temi
Ausgestattet mit einigen selbstentwickelten Bewegungsübungen sowie der Anbindung an die Software JYMMiN, kann Temi Übungen wie Kniebeugen demonstrieren und die richtige Durchführung überwachen. Die Patienten können dabei ihre Lieblingsmusik auswählen, um die Übungen noch ansprechender zu gestalten. Eine Roboterstimme erklärt den Ablauf der Übungen, während die Bewegungen auf dem Display des Roboters vorgemacht werden. Temi ist sogar in der Lage, die korrekte Ausführung der Übungen zu überwachen und bei falscher Haltung eine entsprechende Rückmeldung zu geben, ohne dabei Patientendaten zu speichern. Wird die Übung richtig durchgeführt, steigern sich Übungsgeschwindigkeit, Wiederholungen und auch die Musik wird komplexer. JYMMiN ist eine neue Technologie und ein Trainingskonzept, das musikalische Ausdrucksformen mit körperlicher Bewegung verbindet. Es maximiert durch wissenschaftliche Validierung die Wirkung von Musik beim Training, indem es Schmerzen und subjektive Anstrengung reduziert, Motivation, Stimmung und Spaß steigert, die muskuläre Effizienz und Leistung erhöht und die Aufmerksamkeit sowie kreative kognitive Fähigkeiten verbessert.
Positive Rückmeldungen und zukünftige Perspektiven
Die Rückmeldungen der Patienten waren positiv. Viele Teilnehmer berichteten, dass sie sich durch Temi zusätzlich motiviert fühlten und die Übungen mit mehr Freude durchführten. Besonders bemerkenswert ist, dass der Roboter durch Ablenkung das subjektive Schmerzempfinden reduzieren konnte, wie Julia Beckmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrstuhls Wirtschaftsinformatik und Neue Medien an der Universität Siegen, betont.
Individualisierte Übungsgestaltung
Ein wesentlicher Vorteil von dem sozio-robotischen System ist die Möglichkeit, Übungen individuell an die Bedürfnisse der Patienten anzupassen. Fiona Römer, Physiotherapeutin im MarienAktiv, entwickelte gemeinsam mit dem Team spezifische Übungen für Patienten, die nach Hüft- oder Knieoperationen rehabilitiert werden. Temi ermöglicht es den Patienten, in ihren Pausen selbständig und in ihrem eigenen Tempo zu trainieren, was den Therapieerfolg nachhaltig unterstützt. Obwohl Temi viele Vorteile bietet, betont Fiona Römer, dass der Roboter keinesfalls den menschlichen Kontakt und die Empathie eines Physiotherapeuten ersetzen kann. Temi soll als wertvolle Ergänzung zur traditionellen Therapie dienen und die Patienten zusätzlich motivieren und unterstützen. Der Einsatz des Roboters Temi im Rehakontext zeigt, wie innovative Technologien den Rehabilitationsprozess bereichern und die Motivation der Patienten steigern können. Durch die Kombination von Technologie und menschlicher Betreuung wird ein neues Kapitel in der Rehabilitation aufgeschlagen, das vielversprechende Möglichkeiten für die Zukunft bietet. Ein großer Dank geht an das MarienAktiv Therapiezentrum für ihre Unterstützung und die erfolgreiche Durchführung dieses zukunftsweisenden Projekts – wir hoffen und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit. Weitere Informationen zum Kooperationsprojekt sind in der Siegener Zeitung zu finden: https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/siegen/siegen-marien-aktiv-und-universitaet-siegen-testen-fitness-roboter-temi.html